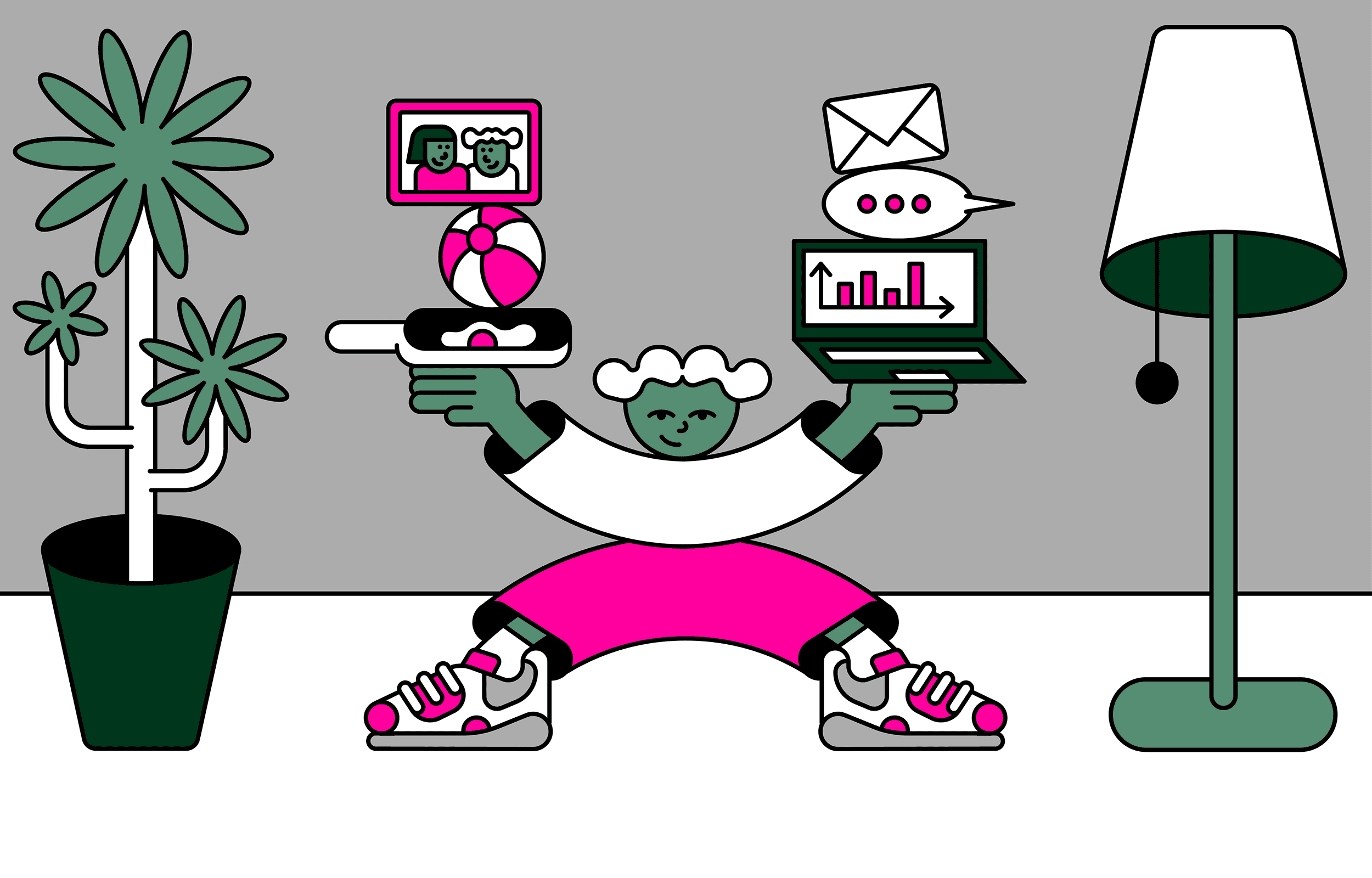
Resilienz stärken
- Illustration
Verena Mack

Mentale Gesundheit trotz Krisen: Das ist der Forschungsschwerpunkt von Dr. Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR). Im Interview erklärt sie, warum Wissenschaftler:innen heute besonders herausgefordert sind und wie man sich Hilfe holen kann.
Petra Schmidt: Sie sind Psychologin und forschen zum Thema Resilienz. Können Sie kurz erläutern, was Resilienz ausmacht und was Sie persönlich an dem Thema interessiert?
Ursprünglich stammt der Begriff aus der Materialwissenschaft und beschreibt Stoffe, die nach ihrer Verformung in die ursprüngliche Gestalt zurückkehren. Dazu gibt es ein sehr anschauliches Bild, das ich gerne verwende und das auch auf den materiellen Ursprung verweist. Es ist der Schwamm. Man kann ihn zusammendrücken, quetschen, kneten, aber er kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Um diese Elastizität geht es auch beim psychologischen Begriff der Resilienz. Wie können wir unsere psychische Gesundheit vor dem Hintergrund schwieriger Lebensumstände aufrechterhalten? Und das ist übrigens auch das, was mich an der Arbeit am LIR begeistert. Nicht mehr warten, bis jemand krank wird, sondern präventiv handeln – und zwar, bevor jemand depressiv wird.
„Resilienz ist nur zum Teil genetisch bedingt.“
Aber wie wird man resilient und welche psychischen Voraussetzungen braucht man dafür?
Früher dachte man, Resilienz sei eine Persönlichkeitseigenschaft. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Heute wird das etwas anders gesehen. Natürlich ist ein Teil dieser Eigenschaft genetisch bedingt, aber ein großer Teil entwickelt sich im Laufe des Lebens und kann sogar trainiert werden. Dabei spielen neurobiologische, aber auch psychologische, soziale und Umweltfaktoren eine Rolle. Es gibt viele Punkte, an denen ein Training ansetzen kann. Wenn ich zum Beispiel sehr stressempfindlich bin, kann ich durch Neurofeedback-Training lernen, meine Hirnaktivität so zu regulieren, dass ich auf unangenehme Reize nicht mehr so stark reagiere. Ich kann aber auch Entspannungstechniken nutzen, um meinen persönlichen Stresspegel zu senken. Oder ich gehe die Stressoren direkt an und schaue, was ich ändern kann. Kann ich einige gezielt ausschalten, zum Beispiel den Zeitdruck am Morgen oder die ständig klingelnden Push-Nachrichten? Andererseits kann ich auch meine Einstellung überprüfen, um Stressoren anders zu bewerten, zum Beispiel als Herausforderung und nicht als Bedrohung.
Helmreich, Isabella et al., Psychological interventions for resilience enhancement in adults. In: Cochrane Database of Systematic Reviews, Februar 2017.
Es kommt also auch auf die eigene Einstellung an?
Resiliente Menschen haben eine Art „Resilienzbrille“ auf, durch die sie die Welt optimistischer und selbstwirksamer betrachten. Diese Haltung ist besonders für Studierende hilfreich, da sie erkennen, dass sie sich auf sich selbst verlassen können und über Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, um sich Wissen anzueignen und Prüfungen zu bestehen. Wichtig ist auch, die eigenen Werte zu kennen und ein Kohärenzgefühl zu entwickeln, um nach Aaron Antonovsky die Welt als verstehbar, sinnvoll und handhabbar zu erleben. Dies gibt Orientierung auch in schwierigen Situationen. Das Kohärenzgefühl kann gestärkt werden, indem man sich besser mit dem Hier und Jetzt und der Welt verbindet, zum Beispiel durch Achtsamkeit oder Meditation, durch Zeit in der Natur oder mit anderen Menschen, aber auch durch Selbstreflexion, zum Beispiel durch das Führen eines Tagebuchs, und durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Grundhaltungen. Resiliente Grundhaltungen ermöglichen einen positiven und aktiven Blick auf die Welt und helfen zu unterscheiden, was veränderbar ist und was nicht.
Wie kann ich aktiv meine Probleme angehen?
Hier gibt es beispielsweise das „aktive Coping“. Dabei geht es darum, die Stressoren zu minimieren – wie bereits erwähnt – oder die eigene Einstellung zu ändern und zu akzeptieren, dass man nicht alles beeinflussen kann. Auch kognitive Flexibilität ist hilfreich, um nicht in alten Mustern zu verharren, sondern neue Perspektiven und Strukturen auszuprobieren.
Einer der wichtigsten Faktoren ist jedoch die soziale Unterstützung, sei es durch ein privates oder berufliches Netzwerk, durch gute Mentor:innen oder, wenn dies nicht ausreicht, durch professionelle Hilfe.
Haben Sie sich in Ihrer Arbeit bereits mit New Work beschäftigt? Wo sehen Sie Überschneidungen?
New Work ist nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt Parallelen zu meiner Arbeit. In beiden Bereichen ist es wichtig, starre Muster aufzubrechen, um den Menschen mehr Handlungsspielraum zu geben. Flexibilität, etwa die Möglichkeit, mal von zu Hause aus zu arbeiten und an anderen Tagen mit Kolleg:innen im Büro zu sein, fördert das soziale Miteinander. So können sich die Menschen am Arbeitsplatz besser entfalten und bleiben belastbar. Insgesamt geht es um die Stärkung des Kohärenzgefühls, denn wenn Autonomie, Eigeninitiative und der soziale Zusammenhalt gefördert werden, erleben die Menschen ihre Arbeit als überschaubarer, nachvollziehbarer und oft auch als sinnvoller.
Welche Auswirkungen der Corona-Epidemie sind heute noch spürbar? Hat sich unsere Resilienz seitdem verändert?
Die Corona-Pandemie hat zum Beispiel das Universitätsstudium stark verändert. Viele Studierende litten damals unter einer erhöhten psychischen Belastung und haben bis heute Schwierigkeiten, in die universitären Strukturen zurückzukehren. Viele haben sich daran gewöhnt, zu Hause zu arbeiten, und finden es schwierig, wieder regelmäßig an Vorlesungen teilzunehmen. Auch der Austausch mit Kommilitonen und Lehrenden ist nicht mehr so intensiv, sodass wichtige Unterstützung und oft auch Vorbilder fehlen. Viele Studierende agieren heute eher als Einzelkämpfer:innen und holen sich seltener Hilfe. Sei es durch Gespräche mit anderen oder durch professionelle Angebote.
„Führungskräfte sollten die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden im Blick haben.“
Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie im Postgraduiertenbereich?
Die Arbeit in der Wissenschaft ist insgesamt sehr belastend und von hohem Leistungsdruck und Arbeitsplatzunsicherheit geprägt. Nachwuchswissenschaftler:innen müssen publizieren, Drittmittel einwerben und haben oft keine geregelten Arbeitszeiten. Unbefristete Stellen sind selten, prekäre Arbeitsverhältnisse eher die Regel. Hinzu kommt ein hoher Konkurrenzdruck, der die Situation zusätzlich erschwert. Vor allem für Frauen ist die Situation alles andere als einfach. Sie stoßen in ihrer beruflichen Laufbahn immer noch häufig an die sogenannte „gläserne Decke“. Vor diesem Hintergrund kommt den Führungskräften eine sehr wichtige Rolle zu. Sie sollten die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden im Blick haben, Vorbild im Umgang mit Stress sein und regelmäßig Unterstützung und Beratung anbieten, zum Beispiel im Rahmen von Mitarbeitendengesprächen. Das ist nicht einfach, aber es ist viel gewonnen, wenn sie sich dieser wichtigen Aufgabe bewusst sind.
Die Leibniz-Gemeinschaft umfasst rund hundert Institute. Was können diese Forschungseinrichtungen tun, um ein resilienzförderndes Arbeitsumfeld zu schaffen?
Wie ein Individuum kann auch eine Organisation an ihrer eigenen Resilienz arbeiten. Dazu ist es wichtig, dass sich die Institution zunächst mit dem Thema psychische Gesundheit und Resilienz auseinandersetzt und offen darüber spricht. Auch hier spielen die Führungskräfte eine wichtige Rolle. Sie müssen sich fragen: Wo können unsere Mitarbeitende Unterstützung bekommen? Können wir Mentoring-Programme einführen? Gibt es regelmäßige Mitarbeitendengespräche? Gibt es Führungskräftetrainings? Wenn diese Fragen geklärt sind, kann nach Angeboten gesucht werden.
Haben Sie Erfahrung mit künstlicher Intelligenz? Könnte KI für Ihre Arbeit nützlich sein?
Wir arbeiten bereits an einer stärkeren Integration von KI und sehen in der Tat ein sehr großes Forschungspotenzial in der Untersuchung von Resilienzdynamiken an der Schnittstelle von Modellierung, maschinellem Lernen und Medizin, insbesondere im Resilienz-Screening unseres Employee Assistance Program, das wir auch allen Leibniz-Instituten anbieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft diejenigen zu unseren Trainings kommen, die es am wenigsten nötig haben. Die stärker Belasteten erreichen wir schwerer. Deshalb haben wir für das Internet ein Resilienz-Screening mit einem Ampelsystem entwickelt, um gezielt belastete Personen herauszufiltern und anzusprechen. In Zukunft könnte KI helfen, solche Screenings zu optimieren, um genau die Personen zu identifizieren, die am stärksten belastet sind. Darüber hinaus könnte eine KI-gesteuerte Anwendung regelmäßige Screenings der aktuellen Belastungen und Ressourcen durchführen, gefährliche Kipppunkte identifizieren und dann individuelle Übungen vorschlagen, um die psychische Gesundheit kontinuierlich zu unterstützen und zu stärken.
Was bringt die Zukunft für Sie persönlich? Woran möchten Sie forschen?
Meine Arbeit konzentriert sich bisher vor allem auf die individuelle Resilienz, aber die Verzahnung mit der Gesellschaft erscheint mir ebenso wichtig. Wir müssen nicht nur die Individuen stärken, sondern – ganz im Sinne des Resilienzforschers Karim Fathi – den Blick auf die Gesellschaft als Ganzes richten, um dort eine Art „Multiresilienz“ im Umgang mit Krisen zu fördern. Zum Beispiel durch die Stärkung des kollektiven Zusammenhalts oder die Nutzung kollektiver Intelligenz, um nachhaltige Lösungen für die anstehenden Herausforderungen unserer Zeit wie den Klimawandel zu entwickeln.
„Ein Drittel aller Menschen entwickelt einmal im Leben eine psychische Erkrankung.“
Können Resilienzprogramme auch missbraucht werden?
Ja, das gibt es. Ein schnelles Resilienztraining als Pille oder „Allheilmittel“, um schnell wieder arbeitsfähig zu sein, sollte nicht das Ziel sein. Resilienzförderung darf nicht dazu missbraucht werden, gesundheitsschädliche Strukturen aufrechtzuerhalten oder die Illusion zu erzeugen, man könne alles bewältigen, wenn man nur genug an sich arbeitet.
Wir sollten auch bedenken, dass etwa ein Drittel aller Menschen einmal im Leben eine psychische Erkrankung entwickelt. Psychische Symptome gehören zum Menschsein. Es ist normal, wütend oder traurig zu sein, und es ist ebenso normal, in eine psychische Krise zu geraten, zum Beispiel wenn jemand stirbt oder man schwer erkrankt. Resilienztrainings und professionelle Unterstützung können helfen, schneller aus einer Krise herauszukommen, aber es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass mangelnde Resilienz der Grund für die Krise oder das Scheitern ist, man sollte sich deswegen nicht selbst die Schuld geben.
Resilienz ist nicht nur eine individuelle Aufgabe, sondern ein gesamtgesellschaftlicher und multisystemischer Ansatz.
Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, das interdisziplinär von Neurobiolog:innen, Physiker:innen, Mediziner:innen und Psycholog:innen geleitet wird. Es erforscht die Fähigkeit, die psychische Gesundheit unter Stress aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Ziel des LIR ist es, die neurowissenschaftlichen Grundlagen der Resilienz zu verstehen, Interventionen zu entwickeln und Lebens- und Arbeitsumgebungen zu verbessern, um Resilienz zu fördern. Es ist das erste Institut seiner Art in Europa und stellt sich einer der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen.
Resilienzförderprogramme
- Für Einzelpersonen: www.lir-mainz.de/fuer-privatpersonen
- Für Organisationen: www.lir-mainz.de/fuer-organisationen
resiLIR
Mit resiLIR bietet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung eine kostenlose Online-Plattform zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Das Angebot umfasst Informationen zum Stand der Forschung, Fragebögen zur Selbsteinschätzung sowie individuelle digitale Resilienztrainings für Fachkräfte und die breite Öffentlichkeit.